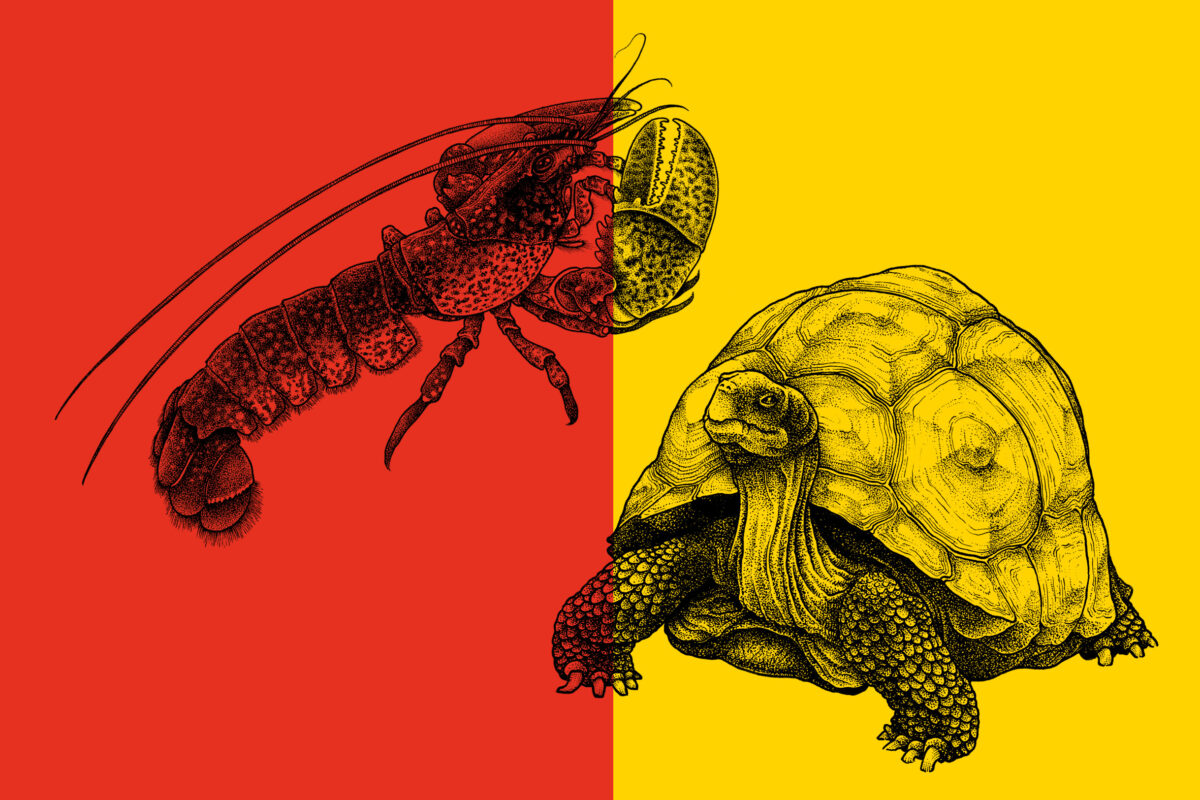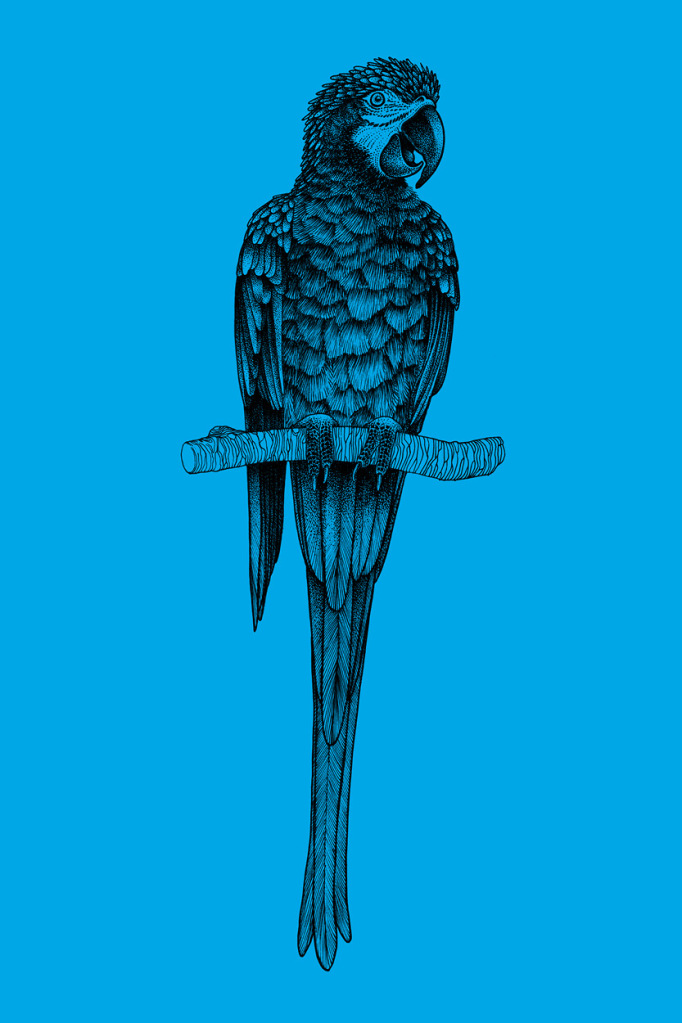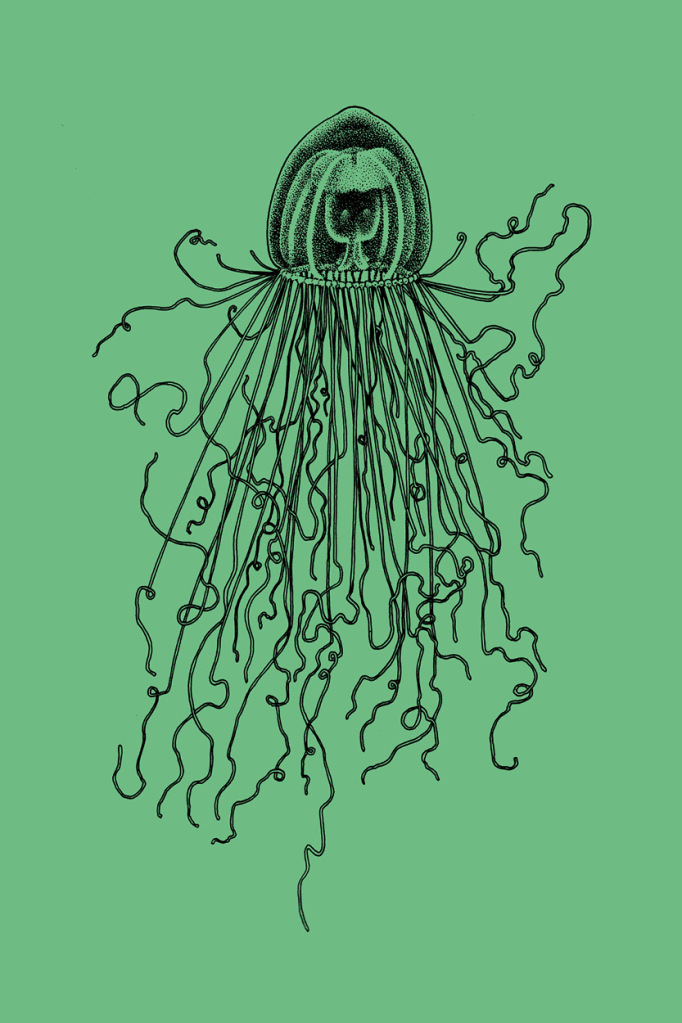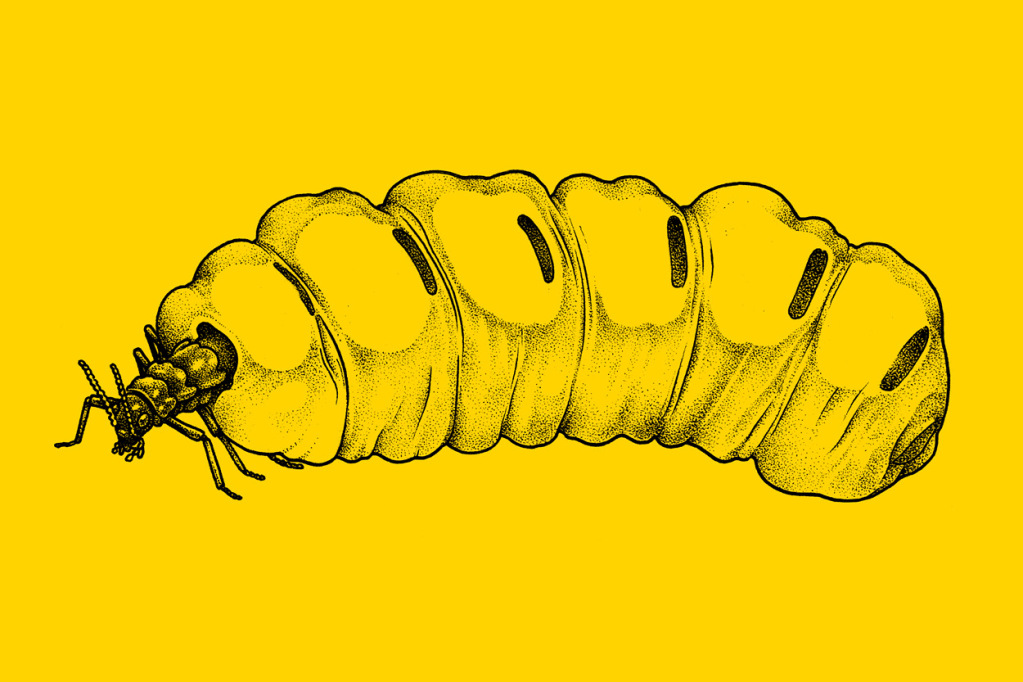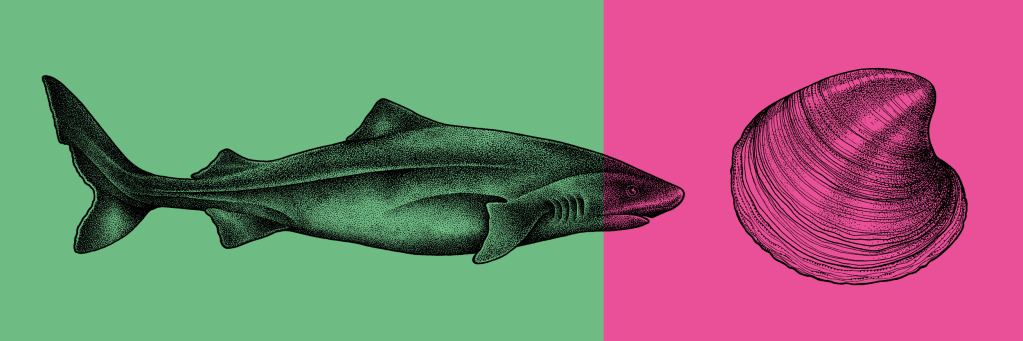Bereits zum zweiten Mal in Folge bleibt die Münchner Theresienwiese Ende September leer. Das berühmte Oktoberfest wurde aufgrund der anhaltenden Pandemie erneut abgesagt. Doch wenn das Oktoberfest Pause macht, serviert Mutter Natur auf der Theresienwiese Kuba-Spinat, Knoblauchsrauke und Kamillentee. Protokoll einer botanischen Feldforschung

Wer zum ersten Mal hier ist, muss denken, die Münchner haben sich auf dem Oktoberfest zu oft ihre Gehirnzellen weggespült. Warum, um alles in der Welt, sollte man diesen Ort sonst als Wiese bezeichnen? Die Theresienwiese ist keine Wiese, sondern ein 42 Hektar großer, lebensfeindlicher Meteoritenkrater aus Schotter und Beton. Die Anwohner haben ein Wort dafür: Theresienwüste.
Für die Stadt gilt die Theresienwiese auch nicht als Grünfläche, sondern als Veranstaltungsort. Hier, südwestlich des Stadtzentrums, lässt man sich in Tracht durch Bierzelte schieben, hängt benebelt im Kettenkarussell oder verzehrt auf Öko-Weihnachtsfestivals Veggie-Döner und Bio-Glühwein. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Der Münchner sucht hier den Rausch, nicht die Natur. Kaum vorstellbar, aber einst war die Fläche Weideland. Als Therese von Sachsen Hildburghausen vor mehr als 200 Jahren per Heirat Prinzessin von Bayern wurde, benannte ihr Volk das Grün vor den Toren der Stadt nach ihr. Botanisch betrachtet ging es seitdem steil bergab. Wo ist sie hin, die Wiese auf der Wiesn?
Wenn einer das beantworten kann, dann ist es Jürgen Feder. Er ist selbst ernannter »Extrembotaniker« und Autor des Buchs »Feders fantastische Stadtpflanzen«. Er sucht die Flora dort, wo keiner sie vermutet: an Autobahnraststätten, auf Bahnhöfen, unter öffentlichen Mülleimern. Seine Überzeugung: Auf dem Land habe die Monokultur die Pflanzenwelt im Griff, vielseitig sei die Flora heute allein in der Stadt.
»Hier sind Pflanzen, die es gern mögen, wenn man sie tritt«
Jürgen Feder, Stadtbotaniker
Es ist ein sonniger Junitag, was blühen kann, blüht – die richtige Jahreszeit für eine Arteninventur. Jürgen Feder ist aus Bremen angereist. Irgendwann ruft er an, weil er die Theresienwiese nicht findet. Nach kurzer Standortbeschreibung stellt sich heraus: Er steht direkt davor. Kein Wunder, dass die Orientierung schwerfällt, eine Wiese gibt es hier ja auch nicht zu sehen. Auf dem Untersuchungsfeld angekommen, stellt sich heraus, dass er das wichtigste Utensil des Tages vergessen hat: seine Artenliste zum Abhaken. »Ist aber kein Problem«, sagt er: »Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, die Liste fülle ich zu Hause aus.« Dann rennt er los. Seine Mission: So viele wilde Arten finden, wie möglich. Gräser, Blumen, Unkraut, was auch immer zu einer Wiese gehört.
Schon nach wenigen Sekunden ertönt ein heiserer Jubelschrei: »Kamille, überall Kamille!« Feder springt über den Platz, als wäre die Kamille auf der Flucht. Vorbei an zwei schwitzenden Männern, die im nördlichen Teil der Festwiese ein Zelt abbauen, eilt er über den Asphalt hin zu einem grünen Fleckchen. Und tatsächlich: Auf einer Insel aus Grashalmen strahlen kleine, weißgelbe Sonnen. Er zerreibt sie zwischen den Fingern, und es riecht nach Bauchweh und Wärmflasche. »Tee ist der Klassiker«, sagt Jürgen Feder, »aber man kann die Blüte auch wunderbar braten, das schmeckt toll!« Dass ausgerechnet an diesem Ort Kamille wächst, sei Zufall, sagt der Botaniker, »viel wahrscheinlicher sind hier Pflanzen, die es gern mögen, wenn man sie tritt.« Er ist es wohl gewöhnt, dass Laien auf solche Aussagen mit Stirnrunzeln reagieren, und lacht: »Echt jetzt, die gibt es! Trittpflanzen heißen die. Moment, ich suche schnell eine!« Dann rennt er wieder.


Jürgen Feder bei der Artenbestimmung zu beobachten ist, als schaue man einem großen, schlaksigen Kind im Spielzeugladen zu. Er stolpert mit leuchtenden Augen auf ein unscheinbares, blassgrünes Hälmchen zu, das sich durch eine Ritze im Asphalt gedrückt hat, kniet nieder und bestaunt es, als wäre es eine seltene Orchidee. Es ist nicht zu bestreiten: Der Mann mit den hellblauen Augen und der heiseren Stimme liebt Pflanzen über alles. »Vogelknöterich«, schreit er beglückt: »Der braucht es zum Beispiel, dass man ab und zu drauftritt. Und Mineralien kann der auch ab, da kann man draufpinkeln, so viel man will, der verträgt alles.« Mit diesen Worten reißt er sich ein Blatt von der Pflanze daneben ab und steckt es sich in den Mund. Kauend erklärt er: »Knoblauchsrauke, die kann man sich aufs Wurstbrot legen.« Jürgen Feder verdreht genießerisch die Augen und erklärt, dass die kleinen Blättchen wie Knoblauch schmecken, nur der Geruch baue sich schneller wieder ab. Ein paar Schritte weiter hat er schon wieder den Mund voll. Zwischen den Fingern hält er einen mickrigen Stängel mit herzförmigen Blättchen. »Beiß mal rein! Hirtentäschelkraut hat mehr Vitamine als eine Zitrone!« Es schmeckt leicht bitter, aber gar nicht übel. Feder starrt konzentriert in die Ferne und visiert bereits die nächste Beute an. Seine Sehkraft ist bewundernswert. Wo für die meisten Laien ein tristes, graues Nichts ist, scheint er auf Dutzende Meter Entfernung den reinsten Dschungel zu erkennen.
»Etwa die Hälfte der Pflanzenarten auf der Theresienwiese sind essbar«
Diesmal hat er etwas in der Hecke entdeckt, hinten, an der Grenze zur Straße. Er kniet sich auf eine Bank und rupft ein tellerförmiges, fleischiges Blatt aus der Hecke. »Kuba-Spinat«, ruft er triumphierend. Der schmecke wie Feldsalat. Man könne ihn roh essen, aber auch wie Spinat kochen. Jürgen Feder genießt ihn pur und auf der Stelle. Von der Nachbarbank aus starren ihn drei ältere Dosenbiertrinker an. »Esst mehr Gemüse«, ruft er ihnen zu und grinst. Die Hälfte der Pflanzenarten hier sind essbar, schätzt der Botaniker.
Die Bestandsaufnahme geht weiter, und bei genauerem Hinsehen ist diese Fläche gar nicht mehr so öde und einheitlich, im Gegenteil: Mal geht man auf Beton, mal auf Kies, und auf der Südhälfte gibt es sogar größere grüne Flächen. Mitten im Grau tauchen manchmal wie aus dem Nichts Büschel hoher Gräser auf, zum Beispiel um Gullis herum oder an Laternenmasten. Kein Zufall, erklärt der Experte, sondern sogenannte Gailstellen, wo Wasser und Nährstoffe zusammenlaufen. »Das ist wie bei den Kuhfladen, da wächst drum herum auch immer mehr«, sagt er. Das gleiche Phänomen finde man in Dörfern um Misthaufen und Ställe herum.
Klicken Sie durch die Bildergalerie: Die Kräuter der Münchner Festwiese
###CustomElementStart###slider###{"sliderId":6897,"images":[{"id":6933,"url":"https:\/\/www.allianz-vor-ort.de\/1890\/\/app\/uploads\/2021\/08\/1890-digital-Allianz-Leere-Wiese_Slider.jpg","width":1250,"height":833,"caption":"","title":"1890 digital-Allianz-Leere Wiese_Slider","description":""},{"id":6934,"url":"https:\/\/www.allianz-vor-ort.de\/1890\/\/app\/uploads\/2021\/08\/1890-digital-Allianz-Leere-Wiese_Slider2.jpg","width":1250,"height":833,"caption":"","title":"1890 digital-Allianz-Leere Wiese_Slider2","description":""},{"id":6935,"url":"https:\/\/www.allianz-vor-ort.de\/1890\/\/app\/uploads\/2021\/08\/1890-digital-Allianz-Leere-Wiese_Slider3.jpg","width":1250,"height":833,"caption":"","title":"1890 digital-Allianz-Leere Wiese_Slider3","description":""}],"withCaption":true}###CustomElementEnd###Als er sich einem eingezäunten Spielplatz nähert, setzt Jürgen Feder ein diabolisches Grinsen auf. »Giftig, ganz giftig!«, zischt er und hat sich schon über den Zaun gewuchtet. An der Wippe bückt er sich nach einem gelb blühenden Kraut. »Da haben wir was ganz Besonderes aus Südafrika«, erklärt er: »Schmalblättriges Greiskraut, das macht sofort Durchfall.« Dass es auf dem Spielplatz den Kindern gefährlich werden könnte, beeindruckt ihn nicht. Er zuckt nur die Achseln: »Man sollte seinen Kindern immer genug Eis kaufen, dann kommen die auch nicht auf Ideen.«
Es geht weiter Richtung Süden. Jürgen Feder hüpft, bleibt abrupt stehen, hockt sich hin, springt wieder auf und bewegt sich lustvoll kauend über die Fläche, die schon viel lebendiger scheint als noch vor einer halben Stunde. Erneut ein Aufschrei: »Ich fasse es nicht, da hinten ist eine Rote-Listen-Art!« Feder sprintet los. In 20 Metern Entfernung haben seine Adleraugen etwas entdeckt. Als er wieder bei Atem ist, erzählt er, dass es sich um einen Rauen Hahnenfuß handele, lateinisch Ranunculus sardous. Er beugt sich schnaufend darüber. »Stufe 3, das heißt, gefährdet«, keucht er: »Das ist echt toll!« In Südeuropa sei der Ranunculus sardous häufiger, hier eigentlich nicht. Dass das Gewächs gerade auf einer Festwiese stehe, sei aber wiederum nicht verwunderlich. »Das liegt wieder am Tritt«, sagt er: »Hier gehen viele Menschen, sie stellen Bierzelte auf, Brauereipferde trampeln herum. All das macht Konkurrenzarten kaputt, die dem Hahnenfuß den Boden wegnehmen würden.« Die gefährdete Pflanze sei robust genug, diese Art der Belastung wegzustecken. Solche Pflanzen nenne man auch Störzeiger, weil sie Störungen brauchen. Menschen, Tiere, Traktoren und zur Not eben auch: das größte Volksfest der Welt. Wäre die Theresienwiese ein Naturschutzgebiet, würden all die Trittpflanzen verschwinden. »Mein erster Fund dieses Jahr«, flüstert Feder und streicht liebevoll über die kleine, gelbe Hahnenfußblüte. Er sieht glücklich aus.
»So eine riesige unbebaute Fläche mitten im Zentrum ist ein Highlight, das hat nicht jede Stadt.«
Jürgen Feder nähert sich einer Böschung im Westen und setzt eine Detektivmiene auf: »Aha, hier machen wohl viele Hunde hin.« Man braucht ihn gar nicht fragend anzuschauen, er ahnt auch so, dass Erklärungsbedarf besteht. Während er den Hang hochsteigt, zeigt er auf den Boden: Löwenzahn. »Das ist ein Nährstoffjunkie, genau wie dieser Stumpfblättrige Ampfer hier, ein Güllezeiger, oder auch das Kletten-Labkraut da hinten.« Er rupft ein großflächiges Blatt ab und hält es sich ans T-Shirt. Die Klette bleibt am Stoff hängen. »Irgendeinen Dünger scheint es hier zu geben«, sagt er nachdenklich, und diesmal hilft ein wenig Münchner Insiderwissen: Er steht mitten in dem Bereich, den man hier auch »Kotzwiese« nennt. Hierhin verziehen sich die Oktoberfestbesucher, die keine Lust aufs Schlangestehen vorm Klohäuschen haben oder die speien müssen.
»Kotzwiese«, sagt Feder nachdenklich und nickt zufrieden: »Daran wird es liegen.« Zwei Stunden später entdeckt der Extrembotaniker immer noch Neues. Jürgen Feder hält einen dünnen Halm namens Hain-Rispengras hoch. »Typisch ist, dass das Blatt im 90-Grad-Winkel vom Stengel absteht«, sagt er.
Mehr als 80 Arten hat der Freund der Stadtpflanzen inzwischen katalogisiert und angesichts dieser Liste zeigt er sich hochzufrieden mit der Theresienwiese. »Das ist eine grüne Lunge«, findet er. »So eine riesige unbebaute Fläche mitten im Zentrum ist ein Highlight, das hat nicht jede Stadt.« Die Theresienwiese hat einen neuen Fan, und zwar einen, der noch nie auf der Wiesn war. Und auch das steht nach diesem Tag fest: Das Wort »Theresienwüste« können die Münchner aus ihrem Wortschatz streichen.

Text Veronika Keller
Foto westend61/Leon Fischer, westend61/Biederbick&Rumpf, Dieter Mayr