Am 22. Oktober 2025 hat die Süddeutsche Zeitung im Ressort »Wissen« über ein Projekt berichtet, das die Allianz federführend versichert. Hier lesen Sie mit freundlicher Genehmigung des Süddeutschen Verlags die Original-Reportage.

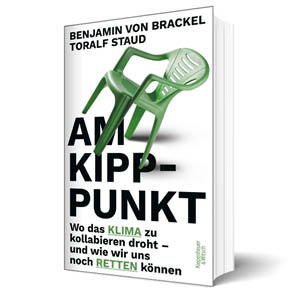
Der Verfasser der Reportage, Benjamin von Brackel, ist freier Autor und Wissenschaftsjournalist für die Süddeutsche Zeitung. Gemeinsam mit Toralf Staud hat er das Buch »Am Kipppunkt« verfasst, das 2025 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist.
Sie bauen in Brandenburg das größte Windrad der Welt
Es könnte die Energiewende im wahrsten Sinne des Wortes auf eine neue Stufe heben. Wenn denn alles gut geht.
Erst als vom Lausitzer Sandboden die Rede ist, verliert Antje Frank kurz ihre fröhliche Miene und stutzt. Hat sie doch nicht alles bedacht? Sie, die seit mehr als 15 Jahren Tag für Tag Risiken prüft und den Plan für das Riesenwindrad gedreht und gewendet hat? Ein paar Sekunden braucht sie, um sich auf der Waldlichtung im Süden Brandenburgs zu sammeln.
Niemand wisse, wie der Untergrund hier nahe der Gemeinde Schipkau beschaffen sei, hat gerade der Mann mit dem Schnauzer neben ihr erklärt, den sie hier alle »den Professor« nennen. Und dass es die Abraumhalde des einstigen Braunkohletagebaus sei.
Und ausgerechnet auf diesem inhomogenen Boden baut der Visionär und Chef der Dresdner Baufirma Gicon, Jochen Großmann, das höchste Windrad der Welt? Nur zur Einordnung: Es wäre das zweithöchste Bauwerk in Deutschland nach dem Berliner Fernsehturm. Aber es wäre nicht statisch, vielmehr wäre der drehende Rotor mächtigen Schwingungen und Windlasten ausgesetzt. Und das alles gründet auf märkischem Karnickelsand?
Viele Jahre haben Ingenieure und Bauplaner an der Idee des Riesenwindrads getüftelt. Mit einer maximalen Rotorhöhe von 365 Metern soll es doppelt so hoch werden wie die aktuelle Generation von Windrädern. Das Kalkül: In dieser Höhe lässt sich mehr und gleichmäßiger Wind ernten, ähnlich wie auf See. Die Höhenwindräder ließen sich in bestehende Windparks integrieren und auch im windschwächeren Bayern oder Baden-Württemberg einsetzen. Das könnte die Energiewende im wahrsten Sinne des Wortes auf eine neue Stufe heben.
Im schlimmsten Fall knickt ein Träger des Windrads weg
Dass diese Idee nun tatsächlich realisiert wird, hat auch mit Antje Frank zu tun. Die 50-Jährige arbeitet für die Allianz. Als »Underwriterin« prüft und bewertet sie Risiken und entscheidet am Ende, ob und zu welchen Konditionen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen wird – und zeichnet dann das Risiko. Die Rolle der Versicherungen ist für Innovationen wie das Riesenwindrad zentral: Ohne Versicherung geben auch die Banken kein Geld. Und die beste Idee bleibt dann genau das: eine Idee.
Für die Versicherungen wiederum sind solche Projekte ein Wagnis und ob der fehlenden Erfahrung schwer zu kalkulieren. Antje Frank hat sich mit einem Versicherungsmathematiker und einem Ingenieur im Haus abgestimmt und Gutachten eingeholt – natürlich auch zu Baugrund und Fundament.
Ein kurzes Grübeln auf der Baustelle bei Schipkau ruft ihr das dann auch wieder in Erinnerung. Schließlich hatte sie im Mai 2025 ihre Unterschrift unter das Angebot für die Bestandsversicherung gesetzt, wie zuvor schon für die sogenannte Montageversicherung. Im Falle eines Totalschadens müsste die Allianz nun bis zu 30 Millionen Euro bezahlen; noch nie hat die gelernte Versicherungskauffrau einen Prototyp mit einer solch hohen Summe versichert.
An diesem wolkenverhangenen Tag Anfang Oktober will sie sich zum ersten Mal selbst ein Bild vom Fortschritt des Riesenwindrads machen. Bevor es aber zur Baustelle geht, fährt sie nach Dresden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Zoos betritt sie eine Gründerzeitvilla: den Sitz der Gicon. In der Eingangshalle steht ein übermannshohes Modell des Riesenwindrads. Im Besprechungsraum wartet Großmann auf die Vertreter der Allianz. Eine Stunde lang beklagt er sich dann über den fehlenden Wagemut in Deutschland.
»Versuch und Irrtum« ist für ihn kein Wahnsinn, sondern ein wissenschaftliches Prinzip. Die Amerikaner und Chinesen würden auf genau diese Weise Innovationen befördern. Hierzulande stürze sich die Presse aber »auf jeden kleinen Fehler« und Konzernchefs agierten nur ängstlich und ohne Weitsicht. »Wenn einer in Deutschland mal gescheitert ist, dann wird er niedergemacht«, kritisiert Großmann.
Er weiß, wovon er spricht, als ehemaliger Technikchef des Hauptstadtflughafens BER war er 2014 wegen verbotener Absprachen entlassen und zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden. Dass man mit dem Riesenwindrad nun doch mal etwas wage, liegt Großmann zufolge vor allem am Partner, der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind), die noch von Angela Merkel ins Leben gerufen worden war, um Technologiesprünge zu fördern. Und an der Allianz, die der Ingenieur überschwänglich für »30 Jahre Zusammenarbeit« lobt.
Großmanns Begeisterung für »mehr Risiko« und eine neue Fehlerkultur teilen die Versicherungsvertreter nicht vorbehaltlos. Um das Risiko einzudämmen, gibt es für eine Versicherung zwei Hebel: Zeit und Masse. Entweder sie setzt auf eine lange Laufzeit des Vertrags oder sie verteilt das Risiko auf breite Schultern, also im Falle einer Technologie auf viele Anlagen. Beim Riesenwindrad trifft keines von beidem zu.
Der Vertrag für die Bestandsversicherung läuft zunächst nur ein Jahr. Im schlimmsten Fall tritt ein Großschaden ein: Ein Kurzschluss oder Blitzeinschlag und das Windrad fängt Feuer. Ein Träger knickt weg oder ein Rotorflügel bricht ab und kracht in den Kiefernforst. Und selbst wenn der Schaden begrenzt ist, könnte der Fall eintreten, dass die Anlage nach Startschwierigkeiten wieder rundläuft – aber die Allianz davon nicht mehr profitiert, weil nach einem Jahr der Betreiber wechselt und der sich einen neuen Versicherer sucht. Deswegen hat sich die Allianz einen zusätzlichen Versicherer mit an Bord geholt, um das Risiko zumindest ein wenig zu streuen.
Nun würde man Jochen Großmann unrecht tun, wenn man ihn als Hasardeur darstellt. Die Fehlerkultur, für die er plädiert, dürfe man nicht mit Nachlässigkeit verwechseln, sagt er. Das wird auf der Baustelle bei Schipkau klar. Von Dresden fahren Frank und Großmann nach Norden. In Schipkau passieren sie Hecken und unscheinbare Häuschen, biegen an der Tankstelle links ab und erreichen über einen Waldweg einen Metallzaun. Dahinter öffnet sich der Kiefernforst und eine Lichtung von der Größe von zweieinhalb Fußballfeldern tut sich auf. Das Erste, was ins Auge fällt, ist ein 150 Meter hoher Kran. Daneben die bereits rund 50 Meter hohe Gitterkonstruktion – der untere Teil des Riesenwindrads.

Antje Frank schlüpft in eine Sicherheitsweste und setzt sich einen Helm auf. Neben Großmann spaziert sie auf den entstehenden Giganten zu. Die Versicherungsfrau blickt nach oben auf den Außenturm, der dem Standbein eines Hochspannungsmasts gleicht. Darin erhebt sich der Innenturm. Immer abwechselnd wachsen beide um 25 Meter. Die Rotoren der beiden Windräder, die sich in einiger Entfernung träge über den Wipfeln der Kiefern drehen, wirken im Vergleich zu dem, was sich hier bald in den Himmel recken wird, fast wie Spielzeug. Dabei, so Großmann, habe man die Grundfläche des Riesenwindrads mit 48 Metern von Ecke zu Ecke so klein gehalten wie nur möglich, um Material zu sparen.
Dann weist er auf den unteren Teil des Außenturms hin. Diesen aufzustellen sei eine Herausforderung gewesen: Die vier je 25 Meter hohen Außenwände lagen zunächst flach am Boden und zu einem Kreuz angeordnet, ehe fünf Kranführer sie parallel an den äußersten Enden hochklappten wie eine Zugbrücke. In der Senkrechten wurden sie austariert und miteinander verbunden. »Wenn sie nur zwei Zentimeter Abweichung hätten und das auf die 300 Meter hochrechnen«, sagt Großmann, »dann steht der da wie der Schiefe Turm von Pisa.«
»Mir ist völlig egal, wann wir in Betrieb gehen«

Noch laufe das Zusammenspiel der Kräne nicht optimal, Maschinen und Material müssten doppelt und dreifach geprüft werden. Das Montagekonzept werde ständig angepasst, erklärt Großmann. Dabei werde jede Schraubendrehung protokolliert, und das bei 80.000 Schrauben, manche so groß wie eine Kleinhantel. »Wir wollen so viel dabei lernen, dass es beim nächsten Mal wirtschaftlich wird«, sagt der Gicon-Chef – und denkt bereits jetzt an Serienproduktion und an finanzstarke potenzielle Partner, mit denen er Tausende Riesenwindanlagen in Deutschland errichten will. »Für die Energiewende kann das der totale Gamechanger werden«, sagt er.
Aber zunächst muss der Prototyp fertig werden. Eigentlich sollte es längst so weit sein, aber Behördenprüfungen und Lieferprobleme haben den Baustart verschoben. Großmann kümmert das wenig. Sicherheit gehe vor Geschwindigkeit. »Mir ist völlig egal, wann wir in Betrieb gehen«, sagt er. »Wenn wir etwas entdecken, über das wir nachdenken müssen, denken wir darüber nach.«
Derzeit plant er mit dem Spätsommer 2026 und erwartet dann auch Kanzler Merz. Der Innenturm wird dann 180 Meter messen – eine Höhe, auf welche die größten Kräne gerade so noch die Turbine setzen können. Ein hydraulischer Apparat wird den Innenturm anschließend samt Turbine wie ein Teleskop nach oben schieben. Für Antje Frank ist das der kritische Moment. »Erst beim Hochfahren sieht man, ob das, was man da zusammengebaut hat, auch wirklich funktioniert.«
In den Tagen davor dürfte auch bei Großmann die Aufregung steigen. Seine Methode, um in solchen Situationen ruhig zu bleiben: Laufschuhe an und ab in den Wald. Er habe das Beste gegeben, um die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schiefgeht, soweit es geht zu minimieren, sagt er. Aber er weiß auch, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt.
Ja, das Riesenwindrad besteht ausschließlich aus erprobten Materialien – aber die Kombination von alldem hat es nie zuvor gegeben.
Ja, die Windverhältnisse in der Höhe wurden ein Jahr lang mit einem Windmessmast vermessen und bis heute mit einem Lidar. Aber in welche Schwingungen die Rotorblätter in den luftigen Höhen tatsächlich geraten, konnte noch niemand testen.
Ja, eine Fundamentplatte samt zwölf Meter langen Pfählen darunter halten das Riesenwindrad gerade. Großmann ist deshalb überzeugt, dass selbst unter der Last des Tausende Tonnen schweren Riesenwindrads die Fundamentplatte nicht absinken wird. Aber wer weiß schon, ob der Brandenburger Boden nicht doch Überraschungen bereithält.
Aber, meint Großmann dann noch lächelnd, bei hundertprozentiger Sicherheit bräuchte er auch keine Versicherung. »Wenn wir uns irgendwo verrechnet haben, dann ist da die Allianz.«
Text Benjamin von Brackel
Fotos Benjamin von Brackel; privat









