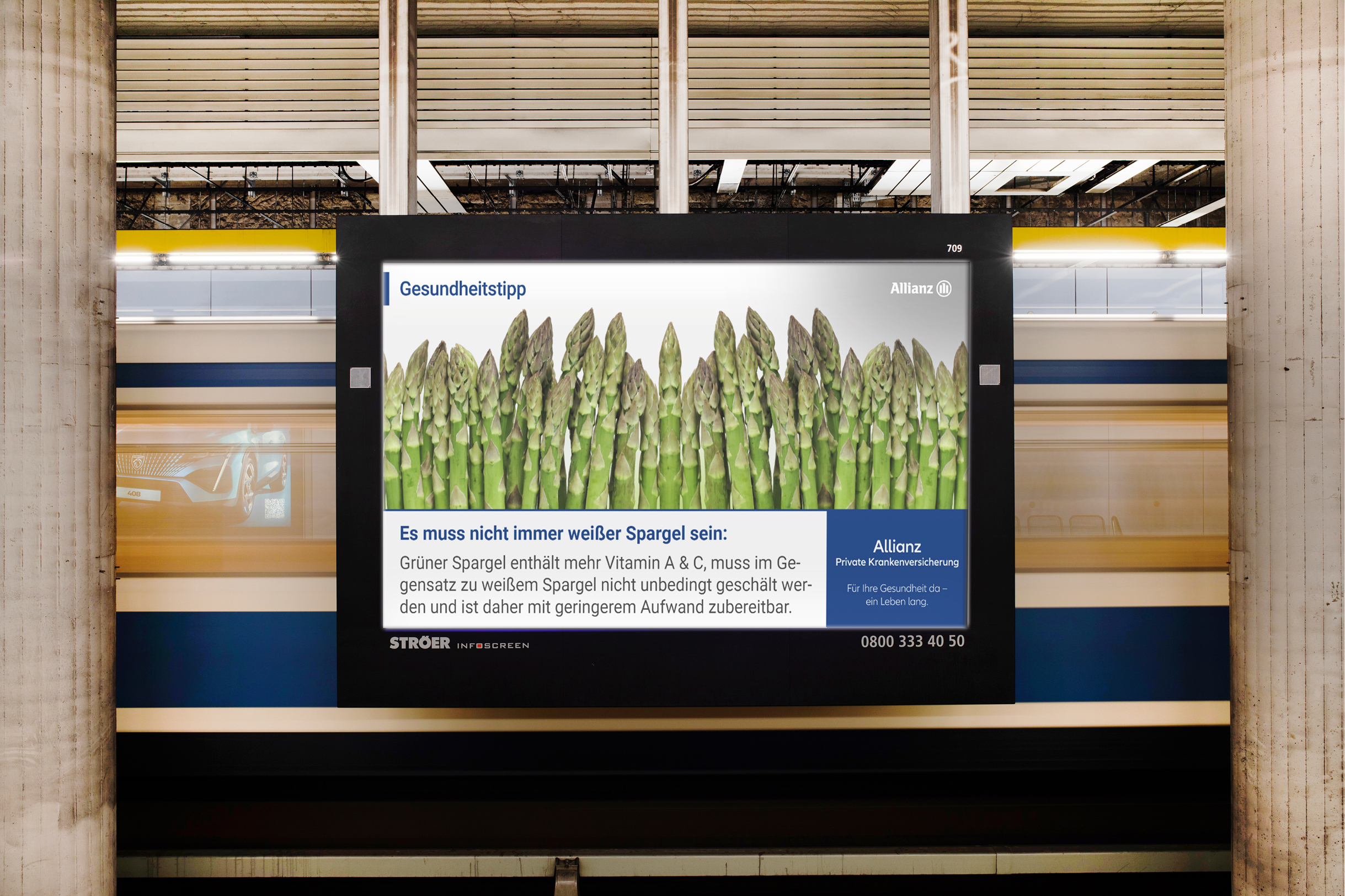Auslandsreporterin Andrea Jeska riskiert immer wieder ihr Leben, um aus Krisengebieten zu berichten. Im Interview erzählt sie, warum sie ihren Job so gerne mag, wie sie den Ukraine-Krieg erlebt hat und warum sie keine Altersabsicherung hat
Zur Person

Andrea Jeska berichtet seit 25 Jahren unter anderem für »Die Zeit« aus Kriegs- und Krisenregionen. Sie hat gut 85 Länder bereist, darunter den Kongo, den Südsudan, Tschetschenien, Irak, Somaliland, Ruanda, Karabach und die Ukraine. Sie wohnt an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste.
Frau Jeska, arbeiten Sie als Kriegsreporterin an vorderster Front?
Nein. Ich gehe selten mit den Soldaten in die Schützengräben. Ich arbeite lieber hinter der Front bei den Menschen, deren Leben durch den Krieg vor ihrer Haustür beeinflusst wird.
Sie haben daher zuletzt viel aus der Ukraine berichtet. Wie kommen Sie an Ihren Arbeitsort?
Meistens fliege ich nach Polen, dann geht es mit dem Bus über die Grenze nach Lwiw und weiter mit dem Nachtzug nach Kiew oder Odessa. Vor Ort habe ich dann meist einen Fahrer, der oft auch mein Dolmetscher ist.
Wie sehen Ihre Arbeitsbedingungen in umkämpften Gebieten aus?
Im Donbass etwa sind in dieser Kriegssituation fast alle Hotels geschlossen. Meistens organisiere ich mir ein Appartement. Zuletzt aber habe ich eine Geschichte über zwei Dörfer gemacht, die mitten in der Feuerlinie liegen. Dort wollten wir in einem leer stehenden Haus übernachten, weil es sonst überhaupt nichts gab. Doch dann fiel Schnee, und es wurde bitterkalt. Also haben der Fotograf und ich auf der Straße eine Frau angesprochen, ob wir bei ihr im Haus übernachten dürfen. Man schläft überall, wo man willkommen ist.
Trotzdem dürften Sie unruhige Nächte und auch Tage haben. Wie gehen Sie mit heiklen Situationen um?
In dem Augenblick selbst habe ich nie Angst. Ich reagiere meist verlangsamt, nie spontan, das ist gut, weil es mir Zeit gibt, Situationen zu evaluieren und keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Ich hatte während solcher Momente nie traumatische, panische Angstmomente. Immer erst hinterher.
Können Sie einen dieser Momente beschreiben?
Als der Ukraine-Krieg begann, hielt ich mich nahe der Front auf. Am Vorabend hieß es noch, es gebe keinen Krieg. Dann ging es um fünf Uhr morgens los, und wir saßen fest. Ein dänischer Kollege wollte mich überreden, ihn ab Kramatorsk zu begleiten. Er hatte ein Auto gekauft, um so außer Landes zu kommen. Mir fehlte der Überblick, und mein Bauchgefühl sagte Nein. Ich brauchte Ruhe und Zeit, um zu entscheiden. In dieser Situation war es absolut richtig: Der dänische Kollege wurde beschossen und schwer verletzt.
Wie groß ist Ihre Risikobereitschaft?
Bei maximalem Engagement sollte man minimales Risiko eingehen. Ich bin auf meiner letzten Reise nicht direkt in das umkämpfte Zentrum von Bachmut gefahren. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil es die Geschichte für mich nicht wert ist. Für meine Reportagen brauche ich viele Eindrücke und keine schnelllebige Kampfsituation, die man eher für die Nachrichten braucht. Dafür ist das Risiko zu hoch, dort zu sterben.
Wie begegnen Sie dem Gedanken, dass der nächste Einsatz auch Ihr letzter sein könnte?
In meinen Anfängen als Kriegsreporterin war ich zu jung, um das Gefühl von Sterblichkeit zu haben. Dieses Gefühl ist erst seit dem Ukraine-Krieg sehr intensiv. Das Risiko, zu sterben, ist da. Aber es ist auch da, wenn ich von Flensburg nach München auf der Autobahn unterwegs bin. Ich will das nicht relativieren, aber es gibt Menschen, die haben jahrzehntelang als Kriegsreporterinnen und -reporter überlebt und sind dann an Covid-19 gestorben oder von der Leiter gefallen.
»Immer dabei habe ich gute, warme Schuhe mit dicken Sohlen für Granatsplitter, Glasscherben oder Trümmerhaufen.«
Kriegsreporterin Andrea Jeska

Sie haben drei Töchter. Wie gehen sie mit dem Berufsrisiko ihrer Mutter um?
Meine Töchter sind inzwischen erwachsen und kennen mein Risiko, seit sie Kinder sind. Trotzdem sind sie nicht immer begeistert: Als ich zu Kriegsbeginn in der Ukraine festsaß und sich der Militärkonvoi auf Kiew zubewegte, hatten sie zum ersten Mal Angst. Sie waren sehr besorgt am Telefon, und ich konnte ihnen nur schwer klarmachen, dass es gar nicht so einfach ist, schnell außer Landes zu kommen.
Welche Ausrüstung nehmen Sie für Ihre Einsätze im Kriegsgebiet mit?
Eine schusssichere Weste, einen Helm und ein spezielles Erste-Hilfe-Set für Kriegssituationen. Das enthält einen Knebel, um Blutungen zu stillen. Wichtig sind auch gute, warme Schuhe mit dicken Sohlen für Granatsplitter, Glasscherben oder Trümmerhaufen.
Sind auch persönliche Gegenstände im Gepäck?
Ein Foto meiner Töchter, Ohrenstöpsel und Lyrik. Ich lese gern Gedichte. Beispielsweise von der russischen Dichterin Anna Achmatowa oder, wenn es ganz übel ist, humorvolle Gedichte von Mascha Kaléko, um wenigstens etwas zum Schmunzeln zu haben.
Wie sind Sie bei Ihren Einsätzen abgesichert, falls doch mal etwas passieren sollte?
Wenn ich für eine Zeitung unterwegs bin, habe ich inzwischen bei manchen Auftraggebern eine sehr teure Krisen- und Risikoversicherung. Dann werde ich im Notfall ausgeflogen, und im Sterbefall würden meine Kinder eine Art Lebensversicherung erhalten. Ansonsten kann ich eine Auslandskrankenversicherung abschließen, um im Notfall rauszukommen.
»Wir freien Reporterinnen und Reporter werden irgendwo hingeschickt, und unsere Auftraggeber fragen nicht, unter welchen Risiken das stattfindet.«
Die aber vermutlich bei Ihren Reiseländern oft gar nicht greift?
Da helfen nur Gottvertrauen und ein gewisser Fatalismus. Ich habe oft gar keine Versicherung. Wir freien Reporterinnen und Reporter werden irgendwo hingeschickt, und unsere Auftraggeber fragen nicht, unter welchen Risiken das stattfindet. Wenn etwas passiert, finden das alle tragisch, und wenn man stirbt, gibt es einen hübschen Nachruf.
Versichern Sie sich denn gegen Berufsunfähigkeit oder für das Alter?
Ich hatte mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die mir aber zu teuer wurde. Ich denke, ich werde immer schreiben können. Eine Altersabsicherung, die das Alter bequem sein lässt, habe ich nicht, und mir ist bewusst, dass das später nicht toll wird. Ich habe die Freiberuflichkeit gewählt, weil sie mir auch die maximale Freiheit in meiner Berichterstattung gibt.
Würden Sie sich als Idealistin bezeichnen?
Wenn es nicht Idealismus ist, der mich antreibt, müsste es Unvernunft sein. Wir Freien sind ganz unten auf der Skala der Bezahlung. Eine richtig gute Altersabsicherung kann ich mir so nicht schaffen. Aber das weiß man. Wenn man nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, muss man es lassen. Trotzdem: Ich mag diesen Job, er ist schön.
Was ist schön, wenn man aus einem Kriegsgebiet berichtet?
Begegnungen mit Menschen, die Charakter, Mut und Rückgrat haben. Gastfreundschaft. Und das Abschiednehmen von der eigenen Wichtigkeit. Zu kapieren, dass man privilegiert ist, dass man demütig und dankbar sein sollte. Das hört sich vielleicht kitschig an, aber ein Krieg relativiert viel.
»Besonders erschüttert hat mich die Geiselnahme von Beslan, bei der mehr als 330 Menschen starben.«
In welchen Ländern gestaltet sich die Recherche besonders schwierig?
In afrikanischen Ländern. Als ich die ersten Male so um 2004 dort war, spürte ich die Angst der Leute vor den Weißen. Sie sagten nicht viel und ließen mich nicht wirklich an sich heran.
Gibt es Erlebnisse, die Sie erschüttert haben?
Die Geiselnahme von Beslan, bei der Terroristen mehr als 1100 Kinder und Erwachsene in einer Schule in Nordossetien in ihre Gewalt gebracht haben. Dort starben mehr als 330 Geiseln. Es gab kaum eine Familie, die kein totes Kind zu beklagen hatte, und die Stadt hat nahezu ihre ganze nachfolgende Generation verloren. Das war der Blick in den Abgrund.
Wenn Sie beruflich durch die Hölle reisen, wie fühlt es sich an, anschließend nach Hause zu kommen?
Ich lebe in einem kleinen, verträumten Dorf an der Ostsee. Mein Zuhause ist der Gegenentwurf zu meinen Recherchen. Und doch fühle ich mich dann oft einsamer als auf meinen Reisen unter lauter Fremden. Zu Hause denke ich, dass ich hier gar nicht mehr so recht hingehöre, aber in die andere Welt, die ich bereise, eben auch nicht. Ich bin wahrscheinlich ein Zwischenmensch, das ist nicht immer leicht zu ertragen.
Weil vielleicht niemand wirklich verstehen kann, was Sie erlebt haben?
Selbst mit allen Bildern, die man sieht und allen Berichten, die man liest: Es ist etwas komplett anderes, vor Ort zu sein. Jede dieser schrecklichen Geschichten, die ich erlebt habe, trennt mich von meiner Welt – von den Leuten in meinem Dorf. Kein Mensch kann Krieg verstehen, wenn er nicht dort gewesen ist.
Interview Katja Fastrich
Fotos privat